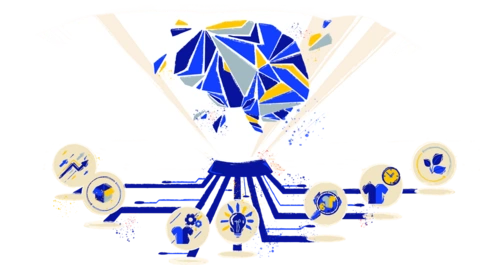So schließt sich der Kreis: Künstliche Intelligenz kann Einzelhändlern helfen, den Dreiklang aus Warenverfügbarkeit, Aussteuerung weniger nachgefragter Ware und dem optimalen Preispunkt für jeden Artikel in Abhängigkeit von dessen Lebenszyklus zu finden – und auf diese Weise nachhaltig Werte zu schaffen.
Das „New Normal“ der Branche fordert den Unternehmen ab, ihr Waren- und Preismanagement zu optimieren. Die Lösung: Künstliche Intelligenz.
Erste Abhilfe bieten die modernen Lösungen der Data Analytics. Wenn zur Datenkomplexität allerdings eine wachsende Zahl von Entscheidungen hinzukommt, die auch noch mit immer größerer Geschwindigkeit getroffen werden müssen, stoßen selbst diese Tools an ihre Grenzen. Die Lösung lautet Künstliche Intelligenz, kurz KI: intelligente Algorithmen, die sowohl das Datenmanagement als auch die vielen, in schneller Abfolge fälligen Entscheidungen beherrschbar machen. Wie solche Ansätze dafür sorgen, dass Unternehmen ihre Warenverfügbarkeit verbessern, ihre Kapitalbindung reduzieren und die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft der Kunden optimal abschöpfen, wollen wir im Folgenden exemplarisch an Praxisbeispielen aus dem Textileinzelhandel zeigen. Klassischerweise entscheiden im Handel – neben dem Shopping-Erlebnis und exzellenter Beratung als Differenzierungsmerkmalen – drei kritische Größen über den Erfolg:
- die Entwicklung der Nachfrage nach den Produkten, die das Unternehmen anbietet
- die Verfügbarkeit der Artikel im eigenen Unternehmen und bei den Mitbewerbern
- das höchste, gerade noch wettbewerbsfähige Preisniveau („so hoch wie möglich, so tief wie nötig“)
Neu ist, dass die Geschwindigkeit, mit der sich diese Größen entwickeln und ein Unternehmen entsprechende Anpassungen vornehmen muss, um ein Vielfaches zugenommen hat. Neben den klassischen stationären Handel sind Pure Player getreten, die schon seit ihrem Markteintritt Kundendaten sammeln, ihre Kundenprofile sowie das Kundenverhalten auswerten und ihre Kunden mit individualisiertem Marketing gezielt ansprechen. Ihr datenbasiertes Vorgehen erlaubt ihnen, Cross-Selling-Potenziale besser auszuschöpfen und ihre Preisgestaltung so feinfühlig wie kurzfristig an der Zahlungsbereitschaft der Kundschaft auszurichten, das Preisniveau des Wettbewerbs immer im Blick. Diese neuen, wendigen, häufig nur im Internet präsenten Anbieter haben bisher nur ein paar Traditionshäuser dazu veranlasst, ihrerseits technologische Kompetenzen aufzubauen und ihre Prozesse zu modernisieren. Doch alle zusammen setzen sie den sonst häufig noch trägen stationären Einzelhandel zunehmend unter Druck.
Genau an diesen Punkten setzt die KI an. Sie erlaubt Händlern, aus dem Kundenverhalten der Vorperiode zu lernen, daraus die Wahrscheinlichkeiten für die weitere Entwicklung der Nachfrage nach Artikeln abzuleiten und die eigene Warenverfügbarkeit und Preislage gegen diese Prognosen zu spiegeln. Mit KI ist es selbst im laufenden Geschäft noch möglich, Veränderungen der Kundenbedürfnisse zu analysieren und kurzfristig darauf zu reagieren.
Was früher über rechenintensive Excel-Modelle gerade noch abbildbar war, sprengen heute allein schon die gewaltigen Datenmengen, die in Unternehmen inzwischen zur Verfügung stehen.

„Künstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität“
— Andrew Ng, US-Informatiker, Vorreiter von KI, Robotik und Online-Lernen
Bislang nehmen nur sehr wenige Marktteilnehmer diese Chance wahr. Deutschlandweit testet gerade einmal eine Handvoll Textileinzelhändler die neue Technologie. Die Resultate dieser KI-Pioniere sprechen allerdings für sich. Drei hier anonymisierte Praxisbeispiele von Händlern mit einem Jahresumsatz zwischen 300 Mio. Euro und 1.200 Mio. Euro, die sich derzeit in der Testphase befinden, verdeutlichen den enormen Wettbewerbsvorteil:

Nachgewiesen wurden diese Ergebnisse in der Proof-of-Concept-Phase, in der die mit KI erzielte Steigerung der Performance – verglichen mit einer Einkaufs- und Pricingsteuerung ohne KI – jeweils mit Hilfe von Test- und Kontrollgruppen gemessen werden konnte. Bemerkenswert daran ist, dass sich in den drei Unternehmen ausnahmslos alle Kennzahlen durch den Einsatz der KI deutlich verbessert haben – und das trotz einer besonders hohen Motivation der Einkäufer in dieser prekären Phase. Der Umsatz stieg durch die ausreichende Warenverfügbarkeit um bis zu 5%. Der Rohertrag legte um 3% bis 10% zu, dank einer um 2 bis 9 Prozentpunkte geringeren Abschriftenquote und der verbesserten Preisabschöpfung. Zugleich erhöhte sich die Abverkaufsquote um bis zu 5 Prozentpunkte.
Einer der Unternehmensverantwortlichen fasste die aktuelle Herausforderung im stationären Einzelhandel treffend zusammen: „Wir wollen Antworten auf die datengesteuerten Geschäftsmodelle der Online-Player finden. Dazu nutzen wir KI.
Wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Alltag konkret aussehen kann, lässt sich an einem anderen Beispiel aus unserer Praxis verdeutlichen. In diesem Fall geht es um einen Einzelhändler mit mehreren Filialen und mehr als 30.000 Artikeln mit entsprechenden Varianten. Die Herausforderung hier: die Warensteuerung und das Pricing stärker miteinander zu verzahnen und die Abläufe so zu optimieren, dass die Rohertragsmargen steigen und das Working Capital sinkt. Das führt zu sehr konkreten Fragen:
- Welche Bestände sind zu welchem Zeitpunkt (wann) in welcher Filiale (wo) nachgefragt – und in welcher Menge (wie viel)?
- Welche Preise sind die Kunden bereit zu bezahlen – und zu welchem Preis gibt es die Artikel beim Wettbewerb?
- Wie können Preisabschriften rechtzeitig erfolgen, sprich so, dass Preise nicht zu früh
(und damit zu Lasten der Rohertragsmarge) reduziert werden, aber auch nicht zu spät (wodurch Absatz an den Wettbewerb verloren geht,
mit negativen Folgen für die Kapitalbindung)?
In unserem Beispiel hat der Einsatz von KI dazu geführt, dass aktuell nur noch rund 60% der Ware initial bestellt und an die Filialen gesendet werden. Die restlichen 40% werden – gesteuert durch die Software – bedarfsgerecht nachbestellt, auf Basis der aktuellen Abverkaufszahlen in den Filialen und so, dass die Warenverfügbarkeit in den Häusern stets gesichert ist. Auf diese Weise wird bereits bei der initialen Disposition vermieden, dass der Händler zu hohe Mengen eines Artikels ordert. Dies reduziert die Notwendigkeit späterer Abverkaufsmaßnahmen deutlich, wodurch neben der Rohertragsmarge auch das Working Capital verbessert wird.
Zugleich ist die KI in der Lage, Top-Seller durch deren Abverkaufsgeschwindigkeit frühzeitig zu erkennen und nachzubestellen. Schwächer performende Artikel hingegen werden durch ihre langsameren Abverkaufszahlen identifiziert und zur Schonung des Working Capital rechtzeitig mit Abschriften versehen oder an Filialen mit höherer Nachfrage für diese Artikel umgeleitet. Zugleich werden sie in der Disposition auf „0“ gesetzt. Letzteres dient der Vermeidung von „Überbestellungen“ und der daraus oftmals resultierenden Wertvernichtung durch Abschriften oder gar Entsorgung. Insofern ist es auch eine Maßnahme im Sinne der Nachhaltigkeit.
Die durch den Einsatz der KI gewonnenen Ressourcen können für die Ausgestaltung des Kollektionsrahmenplanes eingesetzt werden. Wer dies dazu nutzt, ein für die Zielgruppe attraktives Sortiment zusammenzustellen, kann die Wertpositionierung des Unternehmens verbessern und sich damit noch stärker vom Wettbewerb differenzieren. Dabei gilt es, auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Basics aus der Kernkollektion und Artikeln mit Neuigkeitscharakter Wert zu legen. Denn so stark moderne KI auch ist, eine Schwäche hat sie doch: KI kann Prognosen nur aus zuvor Erlerntem ableiten. Welche Trends sich bei der relevanten Zielgruppe künftig durchsetzen, in dem Fall in der Mode, das vermag sie noch nicht vorherzusagen. Hier ist nach wie vor die Kompetenz und das Feingefühl der Sortiments-und Kollektionsverantwortlichen gefragt!
Vor dem Einsatz einer KI sollten ausreichend Ressourcen im Einkauf bereitgestellt werden, um die Artikel mit allen nötigen Informationen ins System einzupflegen. Erst wenn zum Beispiel der voraussichtliche Lebenszyklus eines Artikels im System hinterlegt ist, kann die KI Trendartikel von NOS-Artikeln („never-out-of-stock“) unterscheiden und ihre Vorschläge entsprechend anpassen. Darüber hinaus sollte auf Artikelebene die dazu gehörende Warengruppe (etwa „Classic Men“) und die Produktkategorie (wie „Hemden“) vermerkt werden. Werden diese Daten gepflegt, erkennt die KI die Verfügbarkeit in den Häusern nicht nur auf Artikelebene, sondern auch auf Warengruppenebene – und je Produktkategorie. Aber Achtung: Datenpflege ist mehr als eine einmalige Anstrengung zu Beginn, sondern eine regelmäßig wiederkehrende Aufgabe. Stellen Sie daher vor Einführung einer KI sicher, dass Sie dafür ausreichend Kapazitäten haben. Ebenfalls zu bedenken ist ein zeitlicher Vorlauf von rund zwölf Monaten, bevor eine Künstliche Intelligenz „live“ gehen kann. Ein Unternehmen, das sie im Sommer installiert und mit Daten der vergangenen zwei, drei Jahre füttert, muss die Software mindestens eine Saison mitlaufen lassen, in der die KI anhand des Tagesgeschäfts „lernt“. Erst in der darauffolgenden Saison kann sie dann auch eingesetzt werden, vollumfänglich sobald die Saison – in diesem Fall Herbst-Winter – wiederkehrt.
So unstrittig die Vorteile von KI sind – es bedarf auch künftig der menschlichen Bewertungsleistung und manchmal gesunden Bauchgefühls. Die Stärken der KI liegen im Erkennen von komplizierten Mustern, Regel- und Unregelmäßigkeiten sowie in der Berechnung von (Eintritts-) Wahrscheinlichkeiten und Szenarien. Dazu muss die KI aber zunächst mit Informationen versorgt werden, die in strukturierter Weise aufbereitet sein sollten und durch erfahrene Mitarbeiter plausibilisiert werden sollten. Denn liegt die Stärke dieser kundigen Mitarbeiter aus unternehmerischer Sicht nicht genau darin, die komplexen Sachverhalte wie Kundenbedürfnisse zu erkennen und das Kundenverhalten aus Erfahrungswerten einschätzen und somit prognostizieren zu können? Werden die Erfahrungswerte der Mitarbeiter kombiniert mit der Fähigkeit der KI, immense Datenmengen in höchster Granularität zu analysieren, in Echtzeit, und dem Menschen die Basis für bessere Entscheidungen zu liefern, werden nicht nur die jeweiligen Stärken genutzt – nein, diese Kombination aus Mensch und Maschine bedeutet auch einen ungeheuren Wettbewerbsvorteil!

„Alles, was Menschen leichtfällt, fällt Maschinen schwer und umgekehrt. Das ist eine Riesenchance!“
— Chris Boos, deutscher KI-Pionier und CEO von Arag
Der Einsatz der KI bedeutet für Unternehmen im Textileinzelhandel einen gewaltigen Sprung, insbesondere für die Warensteuerung und die Preisgestaltung.
Hier noch einmal die sieben wesentlichen Vorteile auf einen Blick:
- Deutlich erhöhte Effizienz durch Automatisierung, vor allem in der Auswer tung des Abverkaufs von Artikeln in Echtzeit und der Ableitung von Hand-lungsempfehlungen sowohl für die Initialbestückung als auch für die Nach bestellungen.
- Schnellere Reaktionszeiten und vor allem Beherrschbarkeit des Sortiments auf Artikelebene unter Berücksichtigung von Größen und Farben. 3. Übergreifendes Artikelmanagement und rasche Identifikation von Potenzialen auf Ebene der SKU („stock keeping units“).
- Gezielte Marketingmaßnahmen und optimierte Abschriften auf Basis der laufenden Analyse helfen, bei Überkapazitäten rasch gegenzusteuern.
- Höchstmögliche Abschöpfung der Zahlungsbereitschaft unterschiedlicher Kunden durch die ständige Beobachtung der Wechselwirkung aus Preis gestaltung und jeweils verkaufter Menge; in Folge dessen höhere Warenver fügbarkeit bei gleichzeitig geringeren Warenbeständen.
- Steuerung der Warenbestände innerhalb der Saison, nicht mehr nur saiso-nal; auch anhand des für einen Artikel definierten Lebenszyklus.
- Nachhaltigeres Einkaufs- und Produktionsverhalten wird begünstigt, da der Anteil an eingekauften, jedoch nicht verkauften Waren deutlich reduziert wird.
Derzeit gehen einige Mode-Einzelhändler in Deutschland bereits den nächsten Schritt, indem sie elektronische Preisschilder in den stationären Filialen testen. Dabei werden die Preise durch die KI in Abhängigkeit von Warenverfügbarkeit und Nachfrage vorgeschlagen und nach Freigabe durch den Einkauf direkt in den Filialen auf die elektronischen Preisschilder übertragen. Dies ermöglicht eine standortspezifische Warenaussteuerung durch Pricing und verhindert zugleich, dass durch pauschale Rabattaktionen zu viel Rohertragsmarge verschenkt wird.