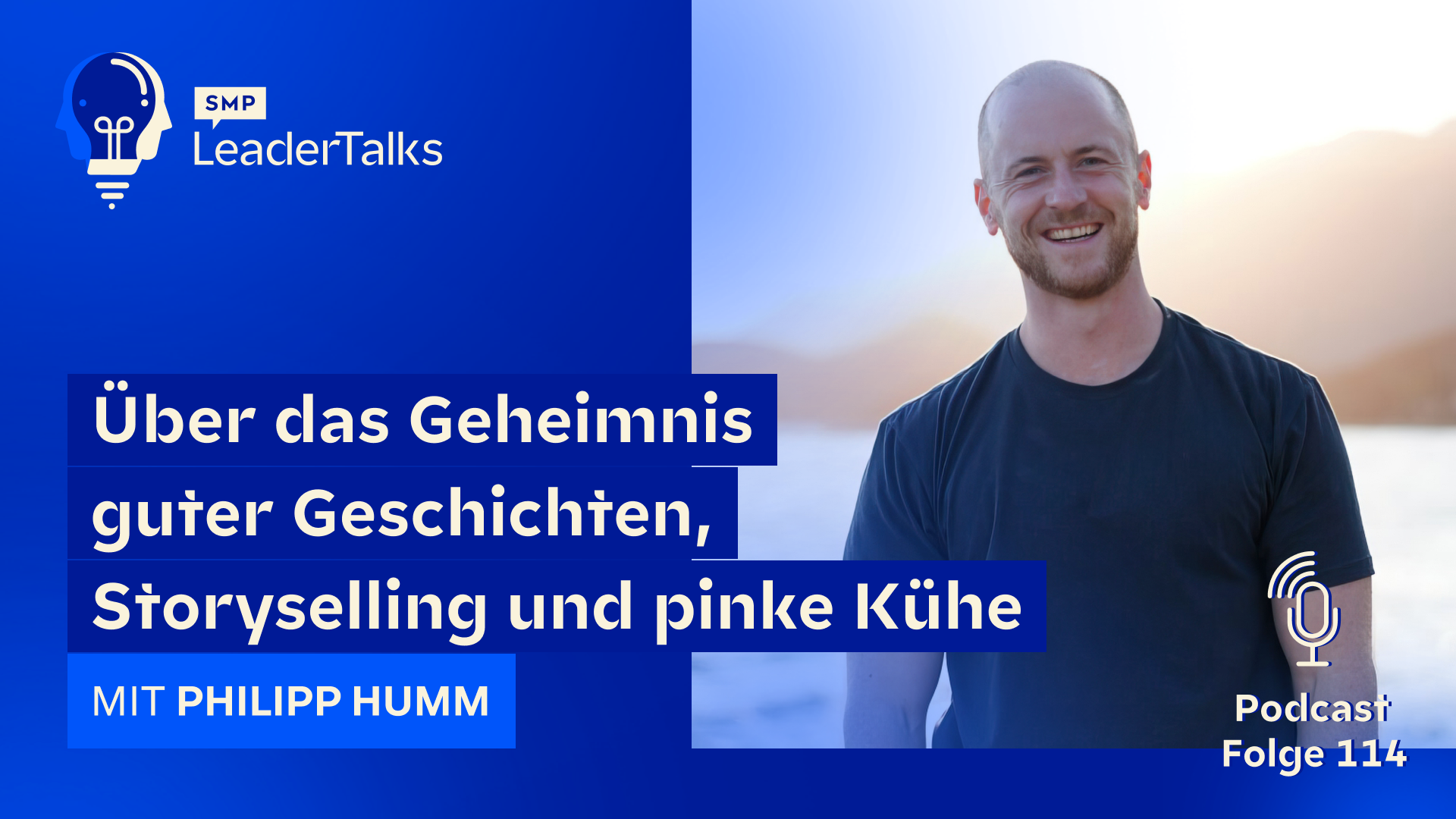Viele Menschen denken beim Stichwort „Storytelling“: Das ist doch nur Marketing!
Zu kalkuliert! Aber das greift zu kurz. Der Grund: Diese Methode bietet Antworten auf ein paar Fragen, die sich im Job immer wieder stellen:
- Wie lassen sich Präsentationen, Keynotes oder Videos lebendiger gestalten?
- Welche Elemente braucht es, damit eine Geschichte die Zuhörer fesselt und eine Botschaft wirksam transportiert?
- Wie schaffe ich es, meine Schüchternheit zu überwinden und zu einem Erzähler zu werden, der die volle Aufmerksamkeit des Publikums hat?
Wer hier Rat sucht, der findet ihn bei Philipp Humm. Ihm fiel es vor Jahren selbst noch schwer, vor Publikum zu sprechen. Er war erfolgreich, arbeitete im Investmentbanking, für eine Unternehmensberatung und später bei Uber, doch wann immer es um Präsentationen ging, wurde er nervös.
Mit Beginn der Pandemie 2020 sollte sich aber alles ändern. Plötzlich arbeitslos geworden, hing Philipp eines Tages vor dem Computer und schaute sinnlos Videos – bis er an einer Werbung hängen blieb. Geschlagene 27 Minuten lang. Selbst darüber verwundert, realisierte er, dass ihn der Mann im Video mit seiner Art der Präsentation einfach so gefesselt hatte, dass er nicht abschalten konnte.
Philipp sagte sich: Das will ich auch können! So befasste er sich mit den Geheimnissen guten Storytellings – und avancierte selbst zu einem gefragten Könner. Heute ist er Coach und Autor mehrerer Bücher zum Thema (wie „Storytelling for Business“). Sein YouTube-Kanal hat mehr als 160.000 Abonnenten.
Schon ein Blick zurück zeigt: Sich Geschichten zu erzählen, gehört zu den Menschen wie die Sprache und das Zusammenleben in Gruppen. Seit jeher dient es dazu, die Welt zu erklären, die Herkunft zu deuten oder Wissen weiterzugeben, und das schon lange, bevor vor mehr als 5.000 Jahren die Schrift erfunden wurde.
Ob es um Traditionen, Rituale, Religiöses oder Tipps für das beste Jagdgebiet ging: Geschichten halfen bei der mündlichen Überlieferung von Informationen und sozialen Normen, sie stärkten den Zusammenhalt. Sie konnten wahre Begebenheiten wiedergeben oder fiktiver Natur sein. Mithilfe des Buchdrucks ließen sie sich weit verbreiten, mit dem Internet sind sie inzwischen wirklich überall leicht verfügbar.
Heute kennen wir Geschichten in unterschiedlichsten Formen: Mythen, Legenden, Fabeln, Sagen, Märchen, Romane, Novellen, Anekdoten und vieles mehr. Je nach Inhalt unterscheiden wir – unter anderem – Helden- oder Liebesgeschichten, Dramen oder Komödien, Bildungsromane oder Tratsch.
Geschichten bleiben hängen, mehr als reine Aufzählungen von Zahlen, Daten und Fakten (weshalb auch Gedächtnistrainer mit Bildern und Geschichten arbeiten).
Bei großen, berühmten Storys reichen häufig schon Stichworte, um vor unserem inneren Auge eindrückliche Bilder, ja ganze Panoramen entstehen zu lassen.
Kain und Abel. David gegen Goliath.
Die Odyssee. Die Nibelungen.
Der „Thrilla in Manila“ von 1974. FC Bayern gegen Manchester United 1999.
Schabowskis Zettel. Der Sturm aufs Kapitol.
Die Hyperinflation von 1923. Die Pleite von Lehman Brothers 2008.
Funktioniert, oder?
Kein Wunder, dass vor rund 30 Jahren die Wirtschaft die Macht von Geschichten entdeckte. Das „Storytelling“ machte sich breit, als neue, gezielt eingesetzte Methode im Wissensmanagement, im Change Management, in Marketing und PR, bei der Schilderung von Gründungsmythen und Historie.
Heutzutage, das weiß jeder Vorstand, jeder Geschäftsführer, müssen Unternehmen mit ihren Produkten und Leistungen am besten Emotionen wecken, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Geschichten helfen dabei. Und so berät Philipp Humm zum Beispiel Führungskräfte von Oracle, Google, E.ON, JPMorgan, Visa oder Zeiss dabei, wie sie ihre Strategie-, Führungs- oder Vertriebsthemen packend vermitteln, ihre Beschäftigten motivieren oder Kunden an sich binden.
Als erfolgreichste Struktur für eine Geschichte hat sich von Odysseus bis Star Wars die Heldenreise bewährt. Der US-Professor Joseph Campbell, der in Religionen und Mythen nach wiederkehrenden Mustern suchte, beschrieb deren Struktur 1949 in 17 Schritten. Der Held wird dabei vor eine Herausforderung gestellt. Auf seinem Weg muss er Widerstände überwinden. Doch am Ende findet er eine Lösung, die Rettung.
Bester „Storyteller“ unserer Zeit war wahrscheinlich Steve Jobs, der legendäre Gründer und CEO von Apple. Seine Vorstellung des iPhone 2007 gilt als eine der besten Präsentationen in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte.
Was Philipp Humm an Storytelling als Teil der Corporate Culture stört: Sie dient primär den Organisationen und ist häufig viel zu kompliziert. Daher destillierte er aus Dutzenden Büchern, Kursen für 27.000 Dollar und Gesprächen mit mehr als 100 Managern das heraus, was dem Einzelnen hilft – und alltagstauglich ist.
„In Meetings habe ich keine Zeit, um eine Story zu erzählen, die 17 Schritte umfasst. Dafür braucht es eine viel kürzere Struktur“, sagt Philipp.
So reduzierte er die vielen Elemente guter Geschichten auf ein simples Modell, das sich ohne Weiteres in Besprechungen, im Aufzug oder bei Präsentationen nutzen lässt, für Geschichten von 90, 60 oder 30 Sekunden Länge.
Das Modell besteht aus vier Schritten:
Kontext: Was ist der Hintergrund der Geschichte, der Zusammenhang, worum geht es für den Charakter (meist den Erzähler selbst)?
Herausforderung: Hier geht es um ein Problem, zum Beispiel um eine schwierige Entscheidung oder einen Konflikt.
Auflösung: Wie hat der Erzähler diese Herausforderung gemeistert?
Erkenntnis: Zum Schluss geht es um das, was sich aus dieser Geschichte lernen lässt.
Wichtig dabei: Um die Zuhörer zu fesseln, sagt Humm, dürfe eine Geschichte die Ereignisse nicht zusammenfassen oder Tatsachen nur benennen („Der Widerstand in der Abteilung war groß“). Dann bleibe sie abstrakt.
Viel besser sei es, die Vogelperspektive zu verlassen und in die konkrete Situation zu gehen, Erlebtes anschaulich zu schildern und die inneren Gedanken oder Konflikte transparent zu machen („Der Abteilungsleiter schaute mich entsetzt an und fragte mit großen Augen: ‚Ist das Ihr Ernst?‘ Auf einmal beschlichen mich Zweifel“).
Wichtige, wiederkehrende Elemente für ein gutes Storytelling sind der Ort (Wo bin ich?), das Handeln (Was mache ich?), die eigenen Überlegungen (Was denke ich?), die persönlichen Emotionen (Was fühle ich?) und kurze, griffige Dialoge (Was höre ich? Wie reagiere ich darauf?). Überraschende Wendungen helfen, ebenso Humor.
Zentral ist auch, sich Geschichten nicht auszudenken. Klingen sie konstruiert oder auswendig gelernt, bewirken sie schnell das Gegenteil dessen, was sie bewirken sollen. Nicht ohne Grund reagieren einige Menschen skeptisch bis ablehnend, wenn sie das Stichwort „Storytelling“ hören.
Umso sinniger ist es, Erlebtes zu notieren und zu sammeln, so dass wir bei Bedarf auf reale Geschichten zurückgreifen können. Das Erzählen zu üben, einen eigenen Ton zu finden. Und stets zu versuchen, die Zuhörer emotional zu packen. Denn am Ende sollen Geschichten die Menschen bewegen und überzeugen.