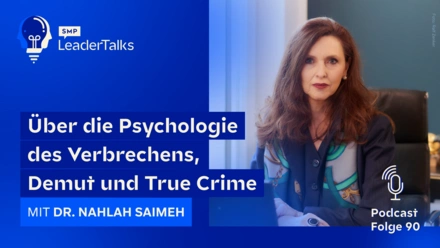Begann der Boom schon in den Sechzigerjahren mit Truman Capotes Buch „Kaltblütig“ und der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“?
Oder erst vor rund 15 Jahren, mit den Büchern von Ferdinand von Schirach, Magazinen wie „STERN Crime“ oder Podcasts wie „ZEIT Verbrechen“?
Sicher ist: Immer mehr Menschen begeistern sich für True-Crime-Formate.
Manche wegen des Schauers, der ihnen bei der Schilderung alter Kriminalfälle über den Rücken läuft. Andere, weil sie sich ehrlich für menschliche Abgründe interessieren. Und viele fragen sich, ob sie wohl selbst zum Täter, zur Täterin werden könnten. Das Böse fasziniert seit jeher.
Auch Dr. Nahlah Saimeh, mein nächster Gast in den „SMP LeaderTalks“, stieß in den vergangenen Jahren mit Büchern über reale Verbrechen (etwa „Jeder kann zum Mörder werden“ oder „Das liebe Böse“) auf großes Interesse.
Als forensische Psychiaterin, die Kliniken geleitet hat und seit ein paar Jahren als selbstständige Gutachterin für die Justizbehörden arbeitet, ist ihr aber zugleich daran gelegen, Verbrechen nüchtern zu schildern und sachlich zu erklären. Eine Dämonisierung von Tätern versucht sie zu vermeiden.
So unterscheiden sich Straftäter in den Augen von Dr. Nahlah Saimeh zum Beispiel nicht grundsätzlich von anderen Menschen.
Vielmehr sind es häufig die Kindheit, die Umstände oder psychische Erkrankungen, die „normale Bürger“ zu Verbrechern werden lassen – obwohl sie es besser wissen.
Für die Prägungen, Beschwernisse und Probleme des Lebens verwendet Saimeh gern das Bild des Rucksacks, den jeder mit sich herumschleppe. Dieser Rucksack falle je nach Milieu, aus dem wir stammten, unterschiedlich schwer aus, wie auch unsere Fähigkeit, ihn zu tragen. Viele kämen damit klar, manche aber eben nicht.
Es bleibt die Faszination für das Düstere, das Mysteriöse, das Unverständliche. Dass mit „True Crime“ inzwischen ein ganzes Genre von der Schilderung realer Kriminalfälle lebt, hängt auch damit zusammen, dass Verbrechen für die meisten Menschen die Ausnahme von der Norm sind und gerade spektakuläre Fälle im Gedächtnis bleiben.
Von den Entführungsfällen Reemtsma, Oetker und Kampusch haben wir wahrscheinlich alle schon einmal gehört.
Von den Mafiamorden in Duisburg.
Oder vom „Kannibalen von Rotenburg“.
Natürlich gibt es die Organisierte Kriminalität, für die Verbrechen so selbstverständlich sind wie der Betrieb einer Bäckerei. Doch für alle anderen sind Morde, Entführungen, Gewalttaten, Betrügereien oder Stalking so spannend, weil sie uns zeigen, wozu der Mensch imstande ist – und weil sie (in der Regel jedenfalls) außerhalb unserer Erfahrungswelt liegen.
Zum Problem wird das Ganze, wenn die ständige Beschäftigung mit alten Verbrechen oder hyperventilierende Berichte zu aktuellen Fällen die Wahrnehmung verzerren. Schon die Tatsache, dass spektakuläre Taten auf zig Kanälen vermeldet und intensiv debattiert werden, lässt einen leicht glauben, dass sie heute häufiger vorkommen als früher – selbst in Fällen, in denen die Statistik etwas Anderes besagt.
In diesem Sinne will ich hier einmal kurz den Rahmen abstecken, was Gewaltverbrechen angeht.
Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland laut der der Polizeilichen Kriminalstatistik rund 217.000 Fälle von Mord, Totschlag, Sexualverbrechen, Raub und gefährlicher oder schwerer Körperverletzung. Dies waren nur 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr, aber eine Zunahme um 20 Prozent, verglichen mit 2019 oder 2014 (als jeweils 181.000 Fälle gezählt wurden).
Speziell bei Mord und Totschlag allerdings, der Lieblingsdisziplin von „True Crime“, ist die Lage überraschend überschaubar.
So gab es 2024 bundesweit nur 222 vollendete, sprich „erfolgreiche“ Morde. Damit bewegt sich diese Zahl weiter auf einem niedrigen Niveau. Von 2014 bis 2017 war sie Statista zufolge schrittweise auf 342 gestiegen, doch seither liegt sie regelmäßig unter der Marke von 250.
Nur zum Vergleich: Laut einer aktuellen US-Studie gab es im vergangenen Jahr allein in Los Angeles 268 Mordfälle.
Zusammen mit Totschlag oder Tötung auf Verlangen kommt die amtliche Statistik hierzulande auf 584 vollende Tötungsdelikte im vergangenen Jahr. Diesen fielen insgesamt 668 Menschen zum Opfer.
Ein genauerer Blick auf „vollendete Tötungsdelikte“ fördert gleich mehrere interessante Erkenntnisse zutage.
Erstens sind sie heute deutlich seltener als noch vor ein paar Jahrzehnten, wie die Untersuchung eines Kriminologen in „Die Kriminalpolizei“ (der Zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei) vor wenigen Jahren zeigte. Ihr zufolge stieg die Zahl vollendeter Fälle von Mord und Totschlag in der alten Bundesrepublik, die nach Start der Statistik 1953 lange Zeit unter 400 gelegen hatte, 1969 erstmals über 600 und 1981 erstmals über 900.
Nach der Wiedervereinigung und der Summierung der Werte für Ost und West erreichte die Statistik dann 1993 ihren traurigen Höchstwert: 1.468.
Seither ist die Zahl der Fälle stark zurückgegangen. Seit 2012 lag sie sogar bis auf wenige Ausnahmen Jahr für Jahr unter 600.
Zweitens werden die Täter meist gefunden, zumindest in den registrierten Fällen. Immer wieder sagen Kritiker, viele Morde blieben unentdeckt, doch bleiben wir einmal bei den offiziellen Zahlen.
Schon bezogen auf alle registrierten Straftaten betrug die Aufklärungsquote der Polizei 2024 gute 58 Prozent. Bezogen auf Gewaltkriminalität betrug sie 77 Prozent. Bezogen auf sämtliche Tötungsdelikte (vollendet und versucht) betrug sie gar 94 Prozent – und so hoch liegt sie seit Jahren!
Drittens sind Tötungsdelikte in Deutschland deutlich seltener als im Rest der Welt. So gibt es pro Jahr hierzulande schon seit längerer Zeit knapp weniger als einen vorsätzlichen Mord je 100.000 Einwohner.
Zum Vergleich lohnt sich ein Blick auf internationale Quoten gemäß einer UN-Organisation: Europa – 2,2. Asien – 2,3 Prozent. Afrika – 12,7. Amerika (Nord und Süd) – 15,0. Einzelne Länder wie Mexiko (28,2), Honduras (38,3) oder Südafrika (mehr als 40) stehen noch schlechter da. Der globale Durchschnittswert: 5,8.
Zu Recht fragt Dr. Saimeh, ob True-Crime-Formate in Ländern, in denen Morde fast zum Alltag gehören, wohl auch auf so ein Interesse stoßen wie hierzulande?
Zusammengefasst lässt sich sagen: Es gibt in Deutschland zurzeit ziemlich wenige Tötungsdelikte, sowohl historisch gesehen als auch im internationalen Vergleich. Und zumindest in den registrierten Fällen werden die Täter fast immer ermittelt.
Was einige Menschen tun lässt, was den meisten von uns undenkbar scheint – das kann Dr. Saimeh sehr anschaulich erklären. Sie sagt: Täter sind nicht per se anders als wir. Wollen wir ihre Verbrechen verstehen, müssen wir vor allem auf ihre Vita, ihre Psyche und die konkreten Umstände der Tat schauen.