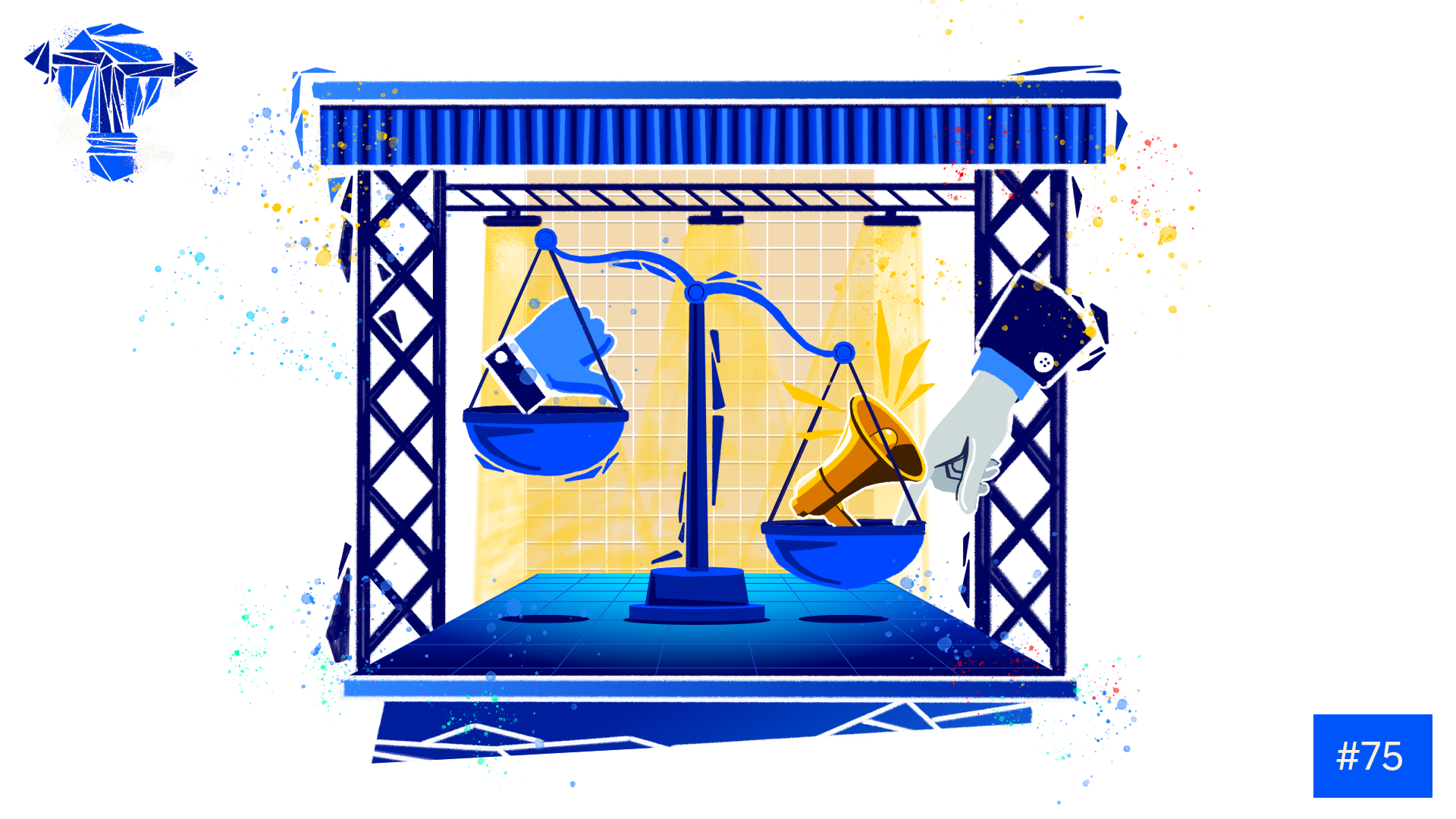Ob wir nun von Moral, Ethik oder sittlichem Verhalten sprechen – die meisten dürften der Ansicht zustimmen, dass eine Gesellschaft gewisser grundlegender Regeln bedarf, um zu funktionieren.
Regeln, die besagen, was „richtig“, was „falsch“ ist, was sich gehört und was nicht.
Im Detail mögen die Ansichten darüber, wie diese Regeln lauten, differieren, zum Beispiel nach Kulturkreis oder Religion. Normal ist es auch, dass sie sich über die Zeit verändern: Alte Normen verlieren an Bedeutung, neue Normen entstehen.
In der Postmoderne gibt es sogar einige Menschen, die am Ende alles für relativ halten. Ihnen gegenüber stehen Philosophen wie Markus Gabriel, die von „moralischen Tatsachen“ sprechen, die unumstößlich seien (diesen hat Gabriel sogar sein neuestes Buch gewidmet, das im Oktober erscheint; mehr im Gespräch mit ihm, das ich vor einigen Monaten mit ihm für die „SMP LeaderTalks“ führen durfte).
Auch ein anderer Gast, der Philosoph und Autor Philipp Hübl, der sich mit Handlungs-, Rationalitäts- und Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie sowie Moralpsychologie befasst, geht davon aus, dass moralische Tatsachen existieren.
Als Beispiel dafür führt er die allgemeinen Menschenrechte an und die Ansicht, dass diese für alle Menschen gelten. Darüber gebe es sicher keine zwei Meinungen, und zwar nirgends auf der Welt. So werde wohl niemand bestreiten, dass es keinem Menschen erlaubt sei, ein Kind aus Spaß zu töten.
Zugleich weist Hübl aber darauf hin, dass vieles, was in einer Gesellschaft erlaubt oder verboten ist, eher einer Konvention entspricht, ähnlich der Frage „Rechts- oder Linksverkehr?“.
Je nach Erziehung, Bildung, Hintergrund und sozialer Gruppe kann die Antwort auf solche Fragen unterschiedlich ausfallen. Ein Streit darüber ist zulässig, ja normal.
Seit einigen Jahren allerdings ist es unverkennbar, dass die Debatten darüber, was „gut“ oder „schlecht“ ist, immer schärfer geführt werden.
Befeuert von der Sichtbarkeit und Logik digitaler Netzwerke, werden Menschen immer härter attackiert, mal für aktuelle Vorgänge, mal für Äußerungen der Vergangenheit, die auf einmal wieder hervorgeholt und kritisiert werden.
Das Problem daran: Viele Diskussionen verlaufen nur noch in Schwarz-Weiß, nicht differenziert. Immer häufiger geht es nicht mehr um die Sache, darum, etwas zu verstehen, zu verzeihen oder gar zu vergessen, sondern um klare, harte Urteile – und um die eigene Positionierung.
So wird es zunehmend schwierig, ehrliche moralische Empörung von der reinen Inszenierung derselben zu unterscheiden.
An dieser Stelle setzte Philipp Hübl 2024 mit seinem Buch „Moralspektakel“ an. Es ist das neueste Werk eines Mannes, der sich immer wieder zwischen Philosophie, gesellschaftlichen Debatten und Diagnosen der Gegenwart bewegt.
Schon mit „Der Untergrund des Denkens“ (2015), „Bullshit-Resistenz“ (2018) und „Die aufgeregte Gesellschaft“ (2019) nahm der gebürtige Hannoveraner den Wandel des modernen Diskurses im Westen in den Blick. Seine Veröffentlichungen fanden viel Resonanz und erhielten mehrere Preise.
Studiert hat Philipp Hübl Philosophie und Sprachwissenschaften. Nach Stationen als Dozent in Aachen und an der Humboldt-Universität Berlin erhielt er 2012 eine Junior-Professur an der Universität Stuttgart, wo er bis 2018 lehrte. Von 2021 bis 2023 arbeitete er dann als Gastprofessor an der Universität der Künste in Berlin.
Im Gespräch für die „SMP LeaderTalks“ unterhielten wir uns über das Paradox, dass viele Menschen ständig nur vom Niedergang sprechen, obgleich sich vieles in der Welt zum Besseren wendet, über Moralkulturen und Opferrollen sowie vor allem über Moral als Signal – das Thema seines jüngsten Buches.
Hübl kommt zu dem Schluss, dass die „richtige“ Haltung heute eine Rolle spielt, wie sie bisher dem beruflichen Erfolg, dem schönen Haus, dem teuren Auto, dem guten Aussehen oder den richtigen Klamotten zukam: Sie ist ein Statussymbol. Sie stärkt und sichert die Stellung in der sozialen Bezugsgruppe.
Andere Menschen für eine Äußerung oder ein Verhalten auf der moralischen Ebene scharf zu kritisieren, am besten noch auf laute, lustige oder spektakuläre Weise, erfüllt Hübl zufolge gleich mehrere Funktionen.
Stand der Kritisierte bisher aufgrund seines Erfolgs, seines Rufs gesellschaftlich über einem, so kann er durch massive Kritik zu den anderen heruntergezogen, auf Augenhöhe gebracht werden. Motto: Wer seine Frau betrügt, andere belügt oder sich anderweitig verwerflich verhält, der ist nicht besser als alle anderen.
Zugleich senden Kritiker klare Signale, welche Maßstäbe sie für wesentlich halten, und damit auch, welcher Gruppe sie sich zugehörig fühlen.
Entsprechend erhalten Kritiker in der Regel positives Feedback aus dieser Gruppe. Sie steigen im Ansehen ihrer Peergroup und häufen moralisches Kapital an. Mit der Zeit können sie sich auf diese Weise Einfluss verschaffen.
Dass es gerade bei Kritik in digitalen Medien häufig nur um symbolische Handlungen geht, um Signale, die nichts kosten und wenig darüber sagen, wie der Kritiker sich selbst im Alltag verhält – das spielt immer weniger eine Rolle.
So hat sich über die Jahre eine Art „Call-out-Culture“ entwickelt, so beschreibt es Philosoph Hübl. Personen, Institutionen oder Unternehmen, die tatsächlich oder vermeintlich gegen moralische Maßstäbe verstoßen haben, werden identifiziert, markiert und attackiert.
Ob an der Kritik etwas dran ist oder ob sie selbst jedes Maß verliert, das ist den Kritikern dabei häufig nachrangig.
Selbst der Streit über diese Streitkultur ist schwierig geworden.
Einerseits ist manche moralisch daherkommende Kritik tatsächlich übertrieben und so massiv, dass sie die berufliche Existenz des Betroffenen bedroht.
Andererseits geht es vielen, die bei öffentlichem Gegenwind sofort eine „Cancel Culture“ wittern, erstaunlich gut. So wie sich moralische Argumente instrumentalisieren lassen, lässt sich auch die Kritik an der Kritik ideologisch nutzen.
Moral als Statusspiel funktioniert am Ende auf beiden Seiten des politischen Spektrums, links wie rechts. Nur dass die Werte, an die jemand appelliert, und die Gruppen, an die er (oder sie) Signale senden möchte, sich unterscheiden.
Als jemand, der sich mit seinen Büchern sowie mit Beiträgen in bekannten Medien wie ZEIT, FAZ, Welt oder Deutschlandradio regelmäßig in aktuelle Diskussionen einmischt, weiß Hübl um die Relevanz, aber auch Brisanz dieses Themas.
Wir alle wollen gute Menschen sein. Die meisten wollen das nach außen demonstrieren. Das ist grundsätzlich auch gar nicht verwerflich – denken wir nur an das sinnvolle Managementprinzip „Leading by example“.
Doch wenn Moral zum Selbstzweck wird und ihre Inszenierung zu Populismus, Symbolpolitik und verzerrter Forschung führt, dann wird es gefährlich.