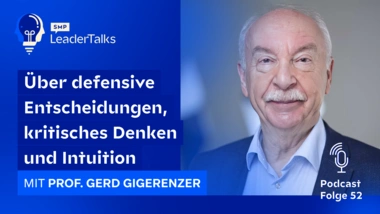Oder: Warum Intuition so wertvoll ist
In Vorbereitung auf mein Gespräch mit Professor Gerd Gigerenzer für die „SMP LeaderTalks“ habe ich mich kürzlich noch einmal eingehender mit dem Thema Bauchentscheidungen und Intuition beschäftigt.
Nur ein simples, aber eindrucksvolles Beispiel:
Etwa die Hälfte ihrer Entscheidungen treffen Topmanager der DAX-Konzerne letztlich aus dem Bauch heraus,
so Gigerenzer, eininternational renommierter Experte für Risikokompetenz, Unsicherheiten und Bildungsforschung. Diese Entscheidungen werden jedoch im Nachhinein meist sehr gut und rational begründet. Die Argumente zu liefern und solche Entscheidungen zu bewerten, genau darin liegt die Existenzberechtigung vieler Beratungsunternehmen – das sollte also ein lukratives Geschäft sein.
Die eigentliche Frage dabei ist: Warum bloß will niemand zugeben, dass er sich intuitiv schon für eine Option entschieden hat?
Ein Teil der Antwort besteht darin, dass der- oder diejenige in diesem Fall natürlich auch die persönliche Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen muss. Und das trauen sich immer weniger Menschen. In seinem Buch „Bauchentscheidungen“ schreibt Gerd Gigerenzerdazu:
„Wir bewegen uns immer mehr weg von einer Leistungskultur und hin zu einer Rechtfertigungskultur.“
Ein anderer Grund für die Scheu ist, dass Intuition einen schlechten, ja fast schon esoterischen Ruf genießt.
Früher wurde Intuition interessanterweise vor allem mit Frauen in Verbindung gebracht, während das Rationale den Männern zugeschrieben wurde. Diese Denktradition, wonach der Verstand der Frauen sich von dem der Männer unterscheide, beeinflusste selbst Immanuel Kant und lässt sich auf Aristoteles‘ Sichtweise zurückführen, dass das Weibliche unvollkommen, weicher, impulsiver und boshafter sei, das Männliche hingegen temperamentvoller, wilder, einfacher und „weniger hinterlistig".
Solche Gedanken hieltensich lange Zeit sehr hartnäckig. So betrachtete zum Beispiel G. Stanley Hall – der erste Präsident der American Psychological Association bei ihrer Gründung im Jahr 1892 – Frauen als intuitiv und gefühlsbetont. Er schrieb ihnen Langsamkeit im logischen Denken zu, auch sah er ihre Stärke eher in der geistigen Reproduktion als in der Produktion. Und zu ungeduldig für Analyse und Wissenschaft waren sie seiner Ansicht nach obendrein.
Derartige, über Jahrhunderte gepflegte Vorurteile haben dem Ruf der Intuition schweren Schaden zugefügt.
Professor Gigerenzer hat in seinen Forschungen gezeigt, dass diese „Herabwürdigung“ der Intuition zu Unrecht erfolgte. Er widersprach damit auch dem kürzlich im Alter von 90 Jahren verstorbenen Nobelpreisträger Daniel Kahneman, der in seinem Buch „Schnelles Denken, langsames Denken“ Bauchentscheidungen als klar irreführend beschrieben hatte. Kognitive Verzerrungen oder Vorurteile führten dazu, dass wir uns von unserer Intuition in die Irre führen ließen. So sagte Kahneman:
„This is the essence of intuitive heuristics: when faced with a difficult question, we often answer an easier one instead, usually without noticing the substitution.”
Das bekannteste Experiment in diesem Zusammenhang ist das „Schläger-Ball-Problem“. Dabei wird die Frage gestellt: Wenn ein Ball und ein Schläger zusammen 1,10 Dollar kosten,und der Schläger 1 Dollar mehr kostet als der Ball – was kostet dann der Ball? Die spontane Antwort von mehr als 80 Prozent der Teilnehmer lautet: Der Ball kostet 10 Cent. Leider ist diese Antwort falsch – richtig wäre die Aussage „5 Cent“. Selbst Teilnehmer aus den besten Universitäten lagen in diesem Experiment zu rund 50 Prozent daneben. Der Grund dafür:Unser Bauchgefühl will Zeit sparen und rechnet nicht mathematisch, stattdessen handelt es nach gelernten Faustregeln.
Gigerenzer zitiert gerne Albert Einstein mit der folgenden Aussage:
„Der intuitive Geist ist ein Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat.“
Er weist damit einerseits darauf hin, dass wir der Intuition wieder mehr Bedeutung einräumen sollten, andererseits darauf, dass wir die beiden Phänomene nicht trennen dürfen. Vielmehr sollten wir lernen, unsere Intuition mithilfe des Verstands zu validieren.
Auch die deutsche Neurowissenschaftlerin, Bestsellerautorin und Beraterin Friederike Fabritius betont:
„Intuitive Entscheidungen sind oft das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und Tausender Stunden Übung. Sie stellen die effizienteste Nutzung Ihrer gesammelten Erfahrung dar.“
Gerd Gigerenzer definiert Intuition durch drei Merkmale: Sie ist demnach
… ein gefühltes Wissen,
… das sehr schnell ins Bewusstsein tritt,
… für das wir aber keine Erklärung haben.
Oft beruht Intuition auf verblüffend simplen Heuristiken. Es sind einfache Regeln, die sich auf das Wesentliche konzentrieren und den Rest ignorieren. Damit stehen sie im Gegensatz zur normalen Entscheidungstheorie, wonach ein Mensch am besten alle Optionen und alle Konsequenzen sorgfältig abwägen sollte.
Für mich persönlich ist es einfach zu unterscheiden, ob Intuition zu richtigen Entscheidungen führen kann oder nicht: Verfügen wir über einen großen Erfahrungsschatz, dann haben wir auch ein unbewusstes, aber gefühltes Wissen. Wir reden somit über eine Bauchentscheidung, nicht über ein reines Raten.
Vor allem in Situationen mit hohen Unsicherheiten gewinnt die Intuition eine besondere Bedeutung. Viele rationale Entscheidungen werden auf Basis bekannter Daten in einer Welt voller unbekannter Variablen getroffen. In diesem Fall helfen Heuristiken und Faustregelnweiter. Eine davon besteht darin, der Mehrheit zu folgen, etwa wenn Sie vor zwei Restaurants stehen, von denen eines voll, das andere ziemlich leer ist. Viele Menschen werden sich, vor die Wahl gestellt, für das volle Restaurant entscheiden. Die Leute werden ja schließlich wissen, was gut ist, oder? Dass dort vielleicht nur so viele Menschen sitzen, weil dort am Anfang ein, zwei Gäste mehr saßen als im anderen Restaurant (was schon reichen kann, um eine Kettenreaktion in Gang zu setzen) – diese Möglichkeit blenden wir aus.
Diese Imitation der Mehrheit ist eine einfache Regel, die Erfolg verspricht, ihn aber keineswegs garantiert. Diese Heuristik könnte auch zu Isomorphismus führen (mehr dazu in meinem Beitrag „Unsere Neigung zu Isomorphismus“).
Sie sollten sich deshalb immer vor Augen führen, dass alle Faustregeln adaptiv zu bewerten sind. Soll heißen: Alles funktioniert nur sinnvoll, wenn wir es im Kontext der Umwelt und unseres Denkens an die jeweilige Situation anpassen. So sagte ein anderer Nobelpreisträger, der US-Sozialwissenschaftler Herbert Simon:
„Human rational behavior is shaped by a scissors whose blades are the structure of task environments and the computational capabilities of the actor.”
Eine weitere sehr bekannte Heuristik ist die „Wiedererkennungsheuristik“: Ihr zufolge wird alles, was wir wiedererkennen oder uns zumindest bekannt vorkommt, von uns als gut, besseroder wahrscheinlicher bewertet. Vielleicht aus diesem Grund geben Markenhersteller viel Geld aus, um die Wiedererkennbarkeit ihrer Marken zu erhöhen.
So steigt auch die Zahlungsbereitschaft von Kunden, wenn Produkte bekannter sind.
Sehr verbreitet und beliebt ist zudem die Heuristik des „Take-The-Best“. Dabei vergleichen wir nacheinander die Eigenschaften von zwei Objekten in der Rangfolge ihrer Bedeutung, bis wir eine Eigenschaft finden, die zwischen den Objekten differenziert und uns besonders valide erscheint. Beispielsweise entscheiden wir uns beim Online-Kauf eines neuen, uns bisher unbekannten Produkts häufig nicht auf Basis eines genauen Studiums der einzelnen Eigenschaften, sondern nach den Kundenbewertungen.
Heuristiken vereinfachen die Welt und stützen sich nur auf eine oder wenige Informationen. Diese Ignoranz gegenüber komplexen Modellen, die dennoch einige Variablen auslassen (wie sogenannte „Optimierungsmodelle“), ist auch die größte Schwäche von Heuristiken. Sie vermitteln eine Scheinsicherheit und lassen uns glauben, eine durchdachte Entscheidung zu treffen.
Intuition erfordert Mut, zumal im unternehmerischen Kontext. Deshalb sind Familienunternehmen häufiger aber auch erfolgreich, denn sie treffen schon eher mal Entscheidungen, weil sie spüren, dass sie damit richtig liegen, und sie bekennen sich auch dazu. Ich kenne viele klassische Patriarchen, die intuitiv die richtigen Entscheidungen getroffen haben (wobei ich leider auch viele kenne, die Fakten bewusst ausgeblendet haben, weil die Entscheidungen sonst sehr unangenehm ausgefallen wären).
Insgesamt möchte ich dafür plädieren, dass wir unserem Bauchgefühl mehr vertrauen. Wir sollten bereit sein, mutig auch die Entscheidungen zu treffen, die wir nicht (sofort) rational begründen können.
Zu diesem Thema kann ich Ihnen die Folge „#52 | Risikokompetenz im unsicheren Leben“ mit Prof. Gigerenzer sehr empfehlen. Diese finden Sie hier. Viel Freude.